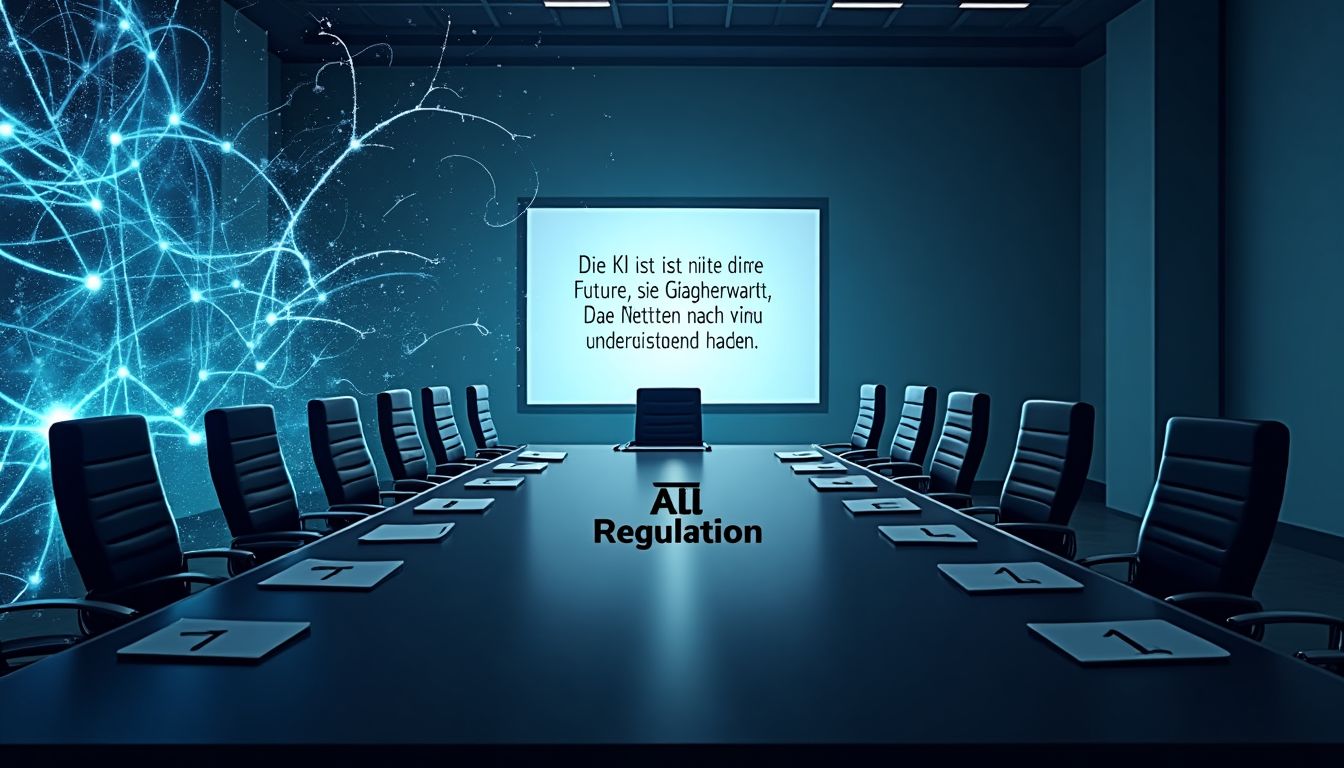Emma Chen, Resort Wirtschaft und KI
In meinem Büro in der Redaktion hängt ein Poster mit dem Zitat „Die KI ist nicht die Zukunft, sie ist die Gegenwart, die die meisten noch nicht verstanden haben.“ Während ich diese Zeilen schreibe, trainiert im Hintergrund ein Algorithmus auf meinem zweiten Bildschirm – ein kleines Experiment zur Textklassifizierung lokaler Wirtschaftsnachrichten. Die künstliche Intelligenz ist längst aus den Laboren der Tech-Giganten in unseren Alltag gesickert, und die Reaktionen darauf könnten unterschiedlicher nicht sein.
Politische Institutionen erwachen langsam
Während mein Algorithmus in Sekunden Muster erkennt, brauchen politische Institutionen Monate, um überhaupt arbeitsfähig zu werden. Das irische Parlament plant einen Sonderausschuss für künstliche Intelligenz – der allerdings frühestens am 7. Mai zusammentreten kann. Die typische Trägheit politischer Systeme zeigt sich hier in voller Pracht: Während die Technologie exponentiell voranschreitet, bewegen sich Regulierungsbemühungen im Schneckentempo.
„Die Politik ist wie ein Elefant, der versucht, einen Kolibri zu fangen“, sagte mir letztes Jahr ein KI-Ethiker auf einer Konferenz in Berlin. Diese Metapher erscheint heute treffender denn je. Während der irische Ausschuss noch nicht einmal seine Arbeit aufgenommen hat, haben KI-Systeme bereits Millionen von Codezeilen geschrieben, Bilder generiert und Entscheidungsprozesse beeinflusst.
Künstler zwischen Ablehnung und Aneignung
Die künstlerische Auseinandersetzung mit KI zeigt eine faszinierende Bandbreite an Reaktionen. Der deutsche Komponist Max Marcoll steht exemplarisch für eine kritische, aber differenzierte Haltung. „AI is its own prison. My job is to break as many bars as I possibly can“, erklärt er in einem Interview. Seine Ablehnung der KI als kreatives Werkzeug basiert nicht auf Angst vor Konkurrenz, sondern auf der Erkenntnis ihrer fundamentalen Limitierung: „Das eine, was KI nicht kann, ist außerhalb der Box zu denken – buchstäblich, weil sie darin gefangen ist.“
Diese Beobachtung deckt sich mit meinen eigenen Erfahrungen aus der KI-Forschung. Die fortschrittlichsten Modelle können beeindruckende Ergebnisse liefern, bleiben aber letztlich in ihren Trainingsdaten gefangen. Sie können existierende Muster erkennen und rekombinieren, aber nicht wirklich innovativ sein.
Marcoll formuliert es prägnant: „Ein Komponist kann sich nur dann von KI bedroht fühlen, wenn er von vornherein nicht wirklich kreativ war.“ Eine provokante These, die den Kern der Debatte trifft: KI wird repetitive, formelhafte kreative Arbeit ersetzen, aber nicht die wahre Innovation.
Technologiekonzerne im Spannungsfeld
Die großen Technologieunternehmen stehen im Zentrum dieser Entwicklung – und damit auch im Zentrum der Kritik. Microsoft, das gerade sein 50-jähriges Bestehen feierte, sah sich mit Protesten konfrontiert, als zwei Mitarbeiter die Jubiläumsfeier unterbrachen. Ihr Vorwurf: Das Unternehmen stelle KI-Technologie für militärische Zwecke zur Verfügung.
Die Reaktion des Unternehmens war unmissverständlich – beide Mitarbeiter wurden entlassen. Microsoft begründete dies mit „Fehlverhalten, das darauf abzielte, Aufmerksamkeit zu erregen und maximale Störung bei dieser mit Spannung erwarteten Veranstaltung zu verursachen.“
Diese Episode illustriert das ethische Dilemma, in dem sich die Tech-Giganten befinden. Einerseits präsentieren sie KI als Werkzeug für das Gemeinwohl, andererseits sind die kommerziellen und militärischen Anwendungen lukrativ und strategisch bedeutsam. Eine Recherche der Associated Press enthüllte Anfang des Jahres, dass KI-Modelle von Microsoft und OpenAI im Rahmen eines israelischen Militärprogramms zur Auswahl von Bombenzielen eingesetzt wurden.
Die KI-Governance-Lücke
Was all diese Entwicklungen verbindet, ist eine fundamentale Governance-Lücke. Während die Technologie mit atemberaubender Geschwindigkeit voranschreitet, hinken Regulierung, ethische Rahmenwerke und gesellschaftlicher Diskurs hinterher.
In meinem Forschungsprojekt an der Dualen Hochschule untersuche ich genau diese Lücke. Die vorläufigen Ergebnisse sind ernüchternd: Nur 23% der von uns befragten Unternehmen in der Region Heilbronn-Franken haben klare ethische Richtlinien für den Einsatz von KI-Systemen. Gleichzeitig setzen bereits 68% KI-Technologien in mindestens einem Geschäftsbereich ein.
Diese Diskrepanz ist symptomatisch für den aktuellen Stand der KI-Revolution. Wir befinden uns in einer Phase, in der die Technologie bereits tiefgreifende Auswirkungen hat, während die gesellschaftlichen Strukturen zu ihrer Steuerung noch im Entstehen sind.
Der Weg nach vorn
Was bedeutet das für die Zukunft? Die KI-Revolution wird sich nicht verlangsamen – im Gegenteil. Die Rechenleistung wächst weiter, die Algorithmen werden sophistizierter, und die Anwendungsbereiche expandieren.
Die Herausforderung besteht darin, parallel zur technologischen Entwicklung robuste Governance-Strukturen aufzubauen. Dies erfordert ein Zusammenspiel verschiedener Akteure:
-
Politik und Regulierungsbehörden müssen agiler werden und proaktive Rahmenwerke schaffen, statt nur reaktiv auf Probleme zu antworten.
-
Technologieunternehmen müssen Verantwortung übernehmen und ethische Überlegungen in den Entwicklungsprozess integrieren.
-
Zivilgesellschaft und Wissenschaft müssen kritische Perspektiven einbringen und als Korrektiv fungieren.
-
Künstler und Kreative müssen die Technologie herausfordern und neue Wege der Nutzung und Kritik finden.
Als ich vor sechs Jahren meine Dissertation begann, war ChatGPT noch nicht einmal ein Konzept. Heute ist es ein Massenphänomen. Diese Geschwindigkeit unterstreicht die Dringlichkeit einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit KI.
In meinem Büro läuft der Algorithmus weiter. Er hat seine Aufgabe fast abgeschlossen – effizienter als jeder menschliche Analyst. Aber die wirklich wichtigen Fragen kann er nicht beantworten: Welche KI-Gesellschaft wollen wir sein? Wer profitiert von dieser Technologie? Und wie stellen wir sicher, dass sie dem Gemeinwohl dient?
Diese Fragen erfordern keinen Algorithmus, sondern einen gesellschaftlichen Diskurs. Einen Diskurs, der genauso schnell und durchdringend sein muss wie die Technologie selbst.
Emma Chen ist Co-Ressortleiterin Wirtschaft & KI bei HEIMATNERD.74 und promoviert zum Thema „KI-Governance in mittelständischen Unternehmen“ an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg.
Quellen
- https://www.irishtimes.com/politics/oireachtas/2025/04/09/oireachtas-committees-due-to-be-operational-in-a-month/
- https://www.irishtimes.com/culture/music/2025/04/09/composer-max-marcoll-ai-is-its-own-prison-my-job-is-to-break-as-many-bars-as-i-possibly-can/
- https://www.news18.com/world/two-microsoft-workers-fired-for-protesting-over-israel-contract-during-50th-anniversary-event-9292128.html